|
Optionsgeschäfte
Inhaltsübersicht
I. Begriffe
II. Optionsgeschäfte und Optionsmärkte
III. Verwendungsmöglichkeiten von Optionen
IV. Preisbildung und ökonomische Bedeutung von Optionen
I. Begriffe
Optionen verkörpern für den Käufer das Recht, eine bestimmte Anzahl von Wertpapieren, Devisen oder anderen Anlagen (bis) zu einem späteren Zeitpunkt zu einem heute festgesetzten Preis zu kaufen (Call) oder zu verkaufen (Put). Wenn sich das Ausübungsrecht auf den letzten Tag der Laufzeit beschränkt, liegt eine europäische Option vor; kann die Option jederzeit vor Verfall ausgeübt werden, so liegt der Typus einer amerikanischen Option vor (diese Bezeichnungen haben keinen geographischen Bezug). Den Preis, zu dem die Papiere gekauft oder verkauft werden können, nennt man Ausübungspreis (Exercise price; Strike price).
Mit einer einmal erworbenen Option kann der Optionär drei Dinge tun: Zunächst kann die Option bis zum Verfall gehalten werden, wo sie entweder ausgeübt wird oder wertlos verfällt. Börsengehandelte Optionen können jederzeit vor dem Verfall verkauft oder glattgestellt werden. Damit wird an Optionsbörsen eine Transaktion bezeichnet, bei der eine bestehende Position durch den Abschluss eines Gegengeschäfts neutralisiert wird. Und letztlich können amerikanische Optionen jederzeit vor dem Verfalldatum ausgeübt werden.
Ob eine Option im Ausübungszeitpunkt ausgeübt wird oder nicht, hängt von der Höhe des Kurses der zugrunde liegenden Anlage im betreffenden Zeitpunkt ab; man bezeichnet diesen als Settlement-Kurs. Eine Calloption wird dann ausgeübt, wenn dieser Kurs über dem Ausübungspreis liegt: die Anlage kann in diesem Fall zu einem Preis unter ihrem Marktwert erworben werden. Umgekehrt verhält es sich bei einer Putoption. Diese wird dann ausgeübt, wenn der Settlement-Kurs unter dem Ausübungspreis liegt. Die Anlage kann in diesem Fall zu einem Preis über ihrem Marktwert veräußert werden. In beiden Fällen liegen die Optionen in-the-money, und es resultiert ein Gewinn in Höhe der (absoluten) Differenz zwischen Settlement-Preis und Ausübungspreis. Da der Käufer einer Option (im Gegensatz zum klassischen Terminkauf/ -verkauf oder zu Futures-Kontrakten) zwar das Recht, nicht aber die Verpflichtung hat, Anlagen zu kaufen oder zu verkaufen, sind bei der Ausübung von Optionen negative Cashflows ausgeschlossen. Liegt bei einem Call (Put) der Settlement-Kurs unter (über) dem Ausübungspreis, so liegt die Option out-of-the-money und wird nicht ausgeübt. Im Grenzfall, wo der Kurs der zugrunde liegenden Anlage ungefähr dem Ausübungspreis entspricht, liegt die Option at-the-money.
Da der Optionär aufgrund seines Wahlrechts nie dem Risiko negativer Cashflows ausgesetzt ist, müssen Optionen gegen Leistung eines Optionspreises von der Gegenpartei erworben werden; die positiven Cashflows aufgrund der Optionsausübung werden demzufolge im Umfang des anfallenden Optionspreises geschmälert. Durch den Verkauf von Optionen verpflichtet sich die Gegenpartie, das Wahlrecht des Optionärs zu erfüllen, also Anlagen zum Ausübungspreis zu liefern (Call) respektive entgegenzunehmen (Put). Da der Käufer von seinem Ausübungsrecht nur dann Gebrauch macht, wenn es für ihn vorteilhaft ist, bewirkt die Optionsausübung für den Verkäufer einer Option immer einen negativen Cashflow: Im Falle einer Calloption muss er die Anlagen stets zu einem Preis unter ihrem Marktwert entgegennehmen. Die potenziellen Verluste des Optionsverkäufers sind symmetrisch zu den potenziellen Gewinnen des Käufers. Der Optionspreis entschädigt den Verkäufer für den im Ausübungsfall resultierenden Verlust und sorgt damit für ein Gleichgewicht zwischen Nachfrage (Kauf) und Angebot (Verkauf) von Optionen. Gleichzeitig wird mit der Leistung des Optionspreises auch die Differenz zwischen allfälligen Haltekosten (Zins auf dem gebundenen Kapital) und Halteerträgen (beispielsweise Dividenden) auf der zugrunde liegenden Kassaposition abgegolten. Mit dem Verkauf einer Option erhofft sich der Investor die Erwirtschaftung eines positiven Cashflows in Form des Optionspreises; dies tritt nur dann ein, wenn die Option für den Käufer wertlos verfällt. Terminologisch bleibt zu ergänzen, dass der Verkauf von Optionen auch als Schreiben von Optionen bezeichnet wird. Der Kauf einer Option führt zu einer long-Position, der Verkauf einer Option zu einer short-Position. Da sich der Wert einer Option, ähnlich wie der Wert eines Futures-Kontraktes, direkt vom Kurs der zugrundeliegenden Anlage „ ableitet “ , werden Options- und Futuresgeschäfte auch als derivative Instrumente oder kurz Derivate bezeichnet.
Im Falle von Zinsoptionen sind zwei spezielle Optionsformen erwähnenswert: Als Cap wird der Maximalzinssatz bezeichnet, der beispielsweise auf einem festverzinslichen Kredit belastet wird. Wenn der Marktzinssatz über den Cap steigt, so kann das Kapital zu einem Zinssatz, der über den Finanzierungskosten liegt, angelegt werden. Ein Cap entspricht demzufolge einem Call auf den vereinbarten Zinssatz. Demgegenüber wird bei einem Floor der Mindestzinssatz garantiert, der auf einer variabel-verzinslichen Ausleihung gutgeschrieben wird. Wenn der Marktzinssatz unter den Floor sinkt, so kann Kapital zu günstigeren Finanzierungskosten beschafft werden. Ein Floor entspricht demzufolge einem Put auf den vereinbarten Zinssatz. Caps und Floors werden allerdings nicht nur in Verbindung mit Ausleihungen, sondern ebenso als eigenständige Finanzkontrakte gehandelt.
Optionen können in unterschiedlichster Weise miteinander kombiniert werden, je nachdem was mit betreffenden Strategien beabsichtigt wird (eine Übersicht liefert Gastineau, G. 1984). Ein Spread beinhaltet den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Calloptionen (Putoptionen) auf denselben Basiswert. Die Optionen unterscheiden sich in der Laufzeit (horizontaler Spread), im Ausübungspreis (vertikaler Spread; Butterfly Spread) oder in beidem (diagonaler Spread). Die Begriffe „ horizontal “ , „ vertikal “ und „ diagonal “ beziehen sich auf die Organisation der Kursnotierungen in Zeitungen und auf Bildschirmen, wo die Restlaufzeiten auf der Horizontalen und die Ausübungspreise auf der Vertikalen notiert sind. Bei einem Straddle werden gleichzeitig Call- und Putoptionen gekauft (verkauft). Viele dieser Transaktionen werden im Rahmen von Arbitragetransaktionen benötigt oder werden zur Konstruktion attraktiver Pay off-Strukturen im Rahmen des Financial Engineering eingesetzt.
Optionen treten auf Finanzmärkten in drei Formen auf: als standardisierte Kontrakte, als börsengehandelte oder außerbörsliche Wertpapiere/Wertrechte oder als Optionsklauseln in traditionellen Anlagen. Optionsgeschäfte gab es seit jeher und überall; so berichtet Aristoteles, dass der griechische Philosoph Thales in Antizipation einer außergewöhnlich guten Olivenernte Optionen auf die Verwendung praktisch sämtlicher Ölpressen im Lande Miletus erworben hat, dadurch einen Corner erzeugt hat und so zu einem unbeschreiblichen Vermögen gekommen ist (nach Bernstein, P. 1992). Bereits gegen Ende des 17. Jahrhunderts hat sich ein relativ gut organisierter Aktienoptionshandel in London entwickelt. Optionsähnliche Klauseln finden sich in praktisch sämtlichen Börsengeschäften. So lassen sich an schweizerischen und französischen Börsen Termingeschäfte auf Aktien durch den Abschluss einer Rücktrittsoption im Falle einer ungünstigen Kursentwicklung annulieren (Prämiengeschäft); die dafür zu bezahlende Prämie stellt einen Optionspreis im oben beschriebenen Sinne dar. Zudem sind traditionelle Wertpapiere mit den vielfältigsten Optionsklauseln ausgestattet. Bei Anleihen hat der Schuldner häufig das Recht, den Anleihebetrag zu einem bei der Emission festgesetzten Rückzahlungskurs vorzeitig zu tilgen. Er wird dies tun, wenn die Zinssätze hinreichend stark gesunken sind und damit der Kurswert der Anleihe über den festgesetzten Rückzahlungskurs gestiegen ist. Der Wert dieser Kündigungsoption äußert sich rationalerweise in einem im Vergleich zu einer unkündbaren Anleihe tieferen Emissionspreis.
Verbreitet sind Optionsscheine (Warrants), die ein Recht zum Erwerb neu emittierter (oder für diesen Zweck reservierter) Unternehmungsanteile verkörpern. Sie werden entweder als eigenständige Wertpapiere oder als Nebenpapier zu Anleihen gehandelt. Im letzten Fall werden sie zusammen mit der Anleihe emittiert, welche zur Kompensation des Optionsrechts einen meistens tieferen Kuponsatz als sonst vergleichbare Anleihen aufweist. Später können die Optionsscheine abgetrennt und an der Börse als eigenständige Papiere gehandelt werden. Immer beliebter sind in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum gedeckte Optionen (coverd warrants) (auch als Stillhalteroptionen bezeichnet) geworden. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, welche von Banken emittiert werden und ein meistens mehrjähriges Optionsrecht auf den Bezug bereits emittierter Aktien, Aktienkörbe u.a. verkörpern, die bei der Bank oder einer ihr nahestehenden Gesellschaft zur Lieferung vorgesehen (stillgelegt) sind. Die Optionen werden nach einer gewissen Zeit an einer Börse notiert und weisen damit einen Sekundärmarkt auf. Andere Optionsinstrumente werden von Banken „ über den Schalter “ (over-the-counter) angeboten; soweit es sich dabei nicht um kundenspezifische Produkte handelt, unterhält die emittierende Bank durch das Stellen von Geld-Brief-Kursen einen Sekundärmarkt. Besonders verbreitet sind diese als OTC-Optionsinstrumente bezeichneten Anlagen in Form strukturierter Absicherungsprodukte, bei denen eine indexierte Vermögensanlage mit einer Mindestrendite auf dem investierten Kapital garantiert wird (vgl. Abschnitt III. 2.).
Den eigentlichen Durchbruch erlebten Optionsgeschäfte mit der Einführung des börsenmäßigen Optionshandels. Die erste Optionsbörse wurde 1973 in Chicago eröffnet (Chicago Board of Exchange, CBOE). Im deutschsprachigen Raum wurde mit der Eröffnung der Swiss Options and Futures Exchange (SOFFEX) im Jahre 1988, der Deutschen Terminbörse (DTB) 1989 und der österreichischen Termin- und Optionsbörse (öTOB) 1991 das Zeitalter der voll computerisierten, derivativen Börsen eingeleitet. Börsengehandelte Optionskontrakte weisen eine Reihe wichtiger Merkmale auf. Zunächst handelt es sich um (meist) zertifikatlose, standardisierte Kontrakte und nicht um Wertpapiere. Die Standardisierung bezieht sich auf die Kontraktgröße (Anzahl der Aktien, Umfang einer Fremdwährungsposition, Nominalwert einer Anleihe), die Spezifikation der zugrunde liegenden Anlagen, die Laufzeit (meistens 1, 2, 3, 6 und 9 Monate) sowie den Ausübungspreis. Im Unterschied zu den meisten Optionsscheinen bezieht sich das Optionsrecht auf bereits ausstehende, also an Kassamärkten gehandelte Anlagen. Als Gegenpartei jeder Transaktion tritt die Optionsbörse, vertreten durch die an ihr tätigen Market Makers, auf. Dadurch werden nicht nur die Suchkosten zum Finden der Gegenpartei einer Transaktion minimal; da die Börse die Marktteilnehmer nicht nur zusammenführt, sondern auch die resultierende Transaktion garantiert, entfällt für die Marktteilnehmer das Bonitätsrisiko bezüglich der Gegenpartie (Counterparty risk). Die Börse sichert sich gegenüber diesen Risiken dadurch ab, dass die Marktteilnehmer, welche auf ihren Positionen Verluste erleiden können, einer Einschusspflicht (Margin requirements) unterliegen, und zwar sowohl bei der Eröffnung als auch bei anschließenden ungünstigen Wertveränderungen ihrer Position. Dazu müssen Sicherheiten über ein Margenkonto bei der Zahlstelle der Optionsbörse (Clearing house) geleistet und andere, im Börsenreglement vorgesehene Garantien nachgewiesen werden.
Die Standardisierung in Verbindung mit der Garantierfunktion der Börse ermöglicht das Zustandekommen und den Abschluss einer großen Zahl von Geschäften und damit eine hohe Marktliquidität. Tatsächlich ist es so, dass das an Options- und Futures-Börsen gehandelte Börsenvolumen ein Mehrfaches des zugrunde liegenden Kassamarktes repräsentiert. Die hohe Liquidität bewirkt, dass volumenmäßig dieselbe Transaktion über Options- und Futuresmärkte billiger, schneller, einfacher und mit einem geringeren Price impact abgewickelt werden kann als über die Kassamärkte. Die Einfachheit der Abwicklung beruht vor allem darauf, dass der börsemäßige Optionshandel zertifikatslos und bei vielen Kontrakten die Optionsausübung als Barandienung (Cash settlement) erfolgt. In diesem Fall wird auf die physische Lieferung von Wertpapieren verzichtet und stattdessen lediglich der Gewinn/ Verlust auf den Konten der beteiligten Parteien ausgeglichen. Diese Form trifft man wesensgemäß bei Aktienindex- und Devisenoptionen immer an.
Eine hohe Liquidität wird auf Optionsmärkten praktisch nur durch eine Marktstruktur ermöglicht, in welcher Händler (Market Makers) verbindliche Geld- und Brief-Kurse stellen, zu denen sie Transaktionen ausführen und auf diese Weise einen Sekundärmarkt in den einmal eröffneten Optionsserien (Laufzeit, Ausführungspreis) aufrechterhalten. Die Marktteilnehmer verfügen damit über verbindliche Preisinformationen als Grundlage ihrer Anlage- und Absicherungsentscheidungen. Die Liquidität lässt sich an der Differenz zwischen dem Geld- und Briefkurs, dem Bid-ask-spread, erkennen: Liquide Optionen weisen i.d.R. einen geringen Spread auf, illiquide einen großen. Das Stellen und die laufende Anpassung der Optionspreise, aber auch die erforderliche Geschwindigkeit bei der Abwicklung von Transaktionen erfordern immer mehr eine Elektronisierung des Optionshandels. An modernen Optionsbörsen wird neben dem Handel auch das Clearing vollelektronisch abgewickelt (EUREX, u.a.). Die Elektronisierung der Börsen bewirkt letztlich auch eine größere Anonymität der Marktteilnehmer, was eine gewisse Adverse Selektion zugunsten informationsmotivierter Transaktionen nach sich ziehen mag (vergleiche Abschnitt III. 1.).
Börsenmäßige Optionen werden in erster Linie auf Aktien und Aktienindizes sowie (im amerikanischen Raum) auf Bonds/Zinssätze und Devisen gehandelt. Zins- und Devisenoptionen werden in Europa dagegen weitgehend durch Banken außerbörslich (over-the-counter) gehandelt. Devisenoptionen wurden in Europa in den frühen 1980er-Jahren eingeführt, und eigenständige Zinsoptionen (Caps, Floors, Swaptions, u.a.) werden seit den späten 1980er-Jahren im Zuge der gestiegenen Nachfrage nach Absicherungsmöglichkeiten von Zinsrisiken durch Finanzintermediäre (Banken, Versicherungen, Vorsorgeeinrichtungen) vermehrt eingesetzt. Daneben sind Optionen auf Edelmetalle und Warentermingeschäfte (Commodities) verbreitet. Der bedeutendste Optionskontrakt ist jener auf den S&P 100-Aktienindex; im Jahre 1999 wurden an der CBOE über 24 Mio. dieser Kontrakte umgesetzt. Hohe Umsätze weisen ferner die Optionskontrakte auf den S&P 500-Aktienindex (23 Mio. Kontrakte) und den deutschen Aktienindex DAX (32 Mio. Kontrakte) auf.
III. Verwendungsmöglichkeiten von Optionen
1. Spekulation
Als Spekulation bezeichnet man jene Transaktionen auf Finanzmärkten, bei denen sich Wirtschaftssubjekte auf der Grundlage subjektiver Erwartungen über zukünftige Preisentwicklungen Ertragschancen versprechen und dafür ein ihrer Risikotoleranz adäquates Preisrisiko in Kauf nehmen. Optionen sind aus verschiedenen Gründen für spekulative Transaktionen besonders geeignet, und gerade deshalb sollten die damit verbundenen Chancen und Risiken besonders gut verstanden werden (Black, F. 1975). Optionen erfordern im Vergleich zur zugrunde liegenden Anlage eine betragsmäßig kleinere finanzielle Investition; dafür partizipiert man nur beschränkt (selektiv) an der Kursentwicklung der zugrunde liegenden Anlage. Wer einen stark steigenden Kurs erwartet, kauft beispielsweise Calloptionen mit einem hohen Ausübungspreis; die Partizipation an der Kursentwicklung der zugrunde liegenden Anlage setzt (im Verfallszeitpunkt) erst dann ein, wenn der Kurs über den Ausübungspreis gestiegen ist. Demgegenüber partizipiert man bei einer Investition in die zugrunde liegende Anlage natürlich an sämtlichen Kurssteigerungen vom Kaufsdatum an. Alternativ könnte die Option vor dem Verfall veräußert (glattgestellt) werden; zwar profitiert man in diesem Fall von vorteilhaften Kursentwicklungen, selbst wenn der Kurs unter dem Ausübungspreis bleibt, doch ist das betragsmäßige Kurspotenzial der Option geringer als bei der zugrunde liegenden Anlage. Sollte der Kurs unerwarteterweise sinken, so erleidet man beim Kauf der Calloptionen zwar einen Verlust, der sich jedoch auf die Höhe des geleisteten Optionspreises beschränkt. Demgegenüber umfasst das Verlustpotenzial einer Investition in die zugrunde liegende Anlage den gesamten Einstandswert.
Optionen ermöglichen, neben Termingeschäften, insbesondere das Ausnützen pessimistischer Preiserwartungen, beispielsweise durch den Kauf von Puts oder durch das Schreiben von Calls. Entsprechende Transaktionen (beispielsweise der Leerverkauf von Aktien) sind auf Kassamärkten vergleichsweise schwierig oder mit höheren Kosten verbunden. Damit liefern Optionsmärkte einfache und kostengünstige Möglichkeiten zur Umsetzung von Strategien, mit denen sich Investoren Gewinnmöglichkeiten durch das Ausnützen subjektiver Preiserwartungen versprechen. Dies trifft selbst dann zu, wenn die Richtung der erwarteten Kursänderung offen ist, also ein Anstieg oder ein Absinken der Volatilität des zugrunde liegenden Kurses erwartet wird. Wenn beispielsweise (im Zusammenhang mit einem Übernahmeangebot) die Chance unerwartet starker Aktienkursanstiege gleichermaßen in Betracht gezogen wird wie die Chance massiver Kursverluste, wird der Investor die angestiegenen Volatilitätserwartungen durch den gleichzeitigen Erwerb von Call- und Putoptionen auszunutzen versuchen.
Der betragsmäßig kleineren Investition steht bei Optionen ein hohes Kursrisiko gegenüber. Das Kursrisiko einer Anlage wird in der Finanzmarkttheorie mit den relativen (prozentualen) Kursänderungen respektive deren Standardabweichung gemessen; man spricht auch von der Volatilität der Anlage. Eine zentrale Eigenschaft von Optionspreisen besteht darin, dass die prozentualen Preisänderungen wesentlich stärker ausfallen als jene des zugrunde liegenden Kassakurses. Das Verhältnis zwischen der Volatilität der Option und der Volatilität der zugrunde liegenden Anlage bezeichnet man als Hebe, Elastizität oder Leverage-Faktor. Er berechnet sich mit
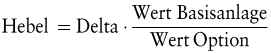
Das Delta einer Option zeigt die Abhängigkeit des Optionspreises von kleinen Veränderungen des zugrunde liegenden Kassakurses und liegt bei Calls (Puts) immer zwischen 0 und 1 ( – 1). Das Delta erfüllt eine wichtige Rolle beim Hedging und der Bewertung von Optionen. Der Hebel zeigt hingegen direkt das relative Preisrisiko einer Option gegenüber der zugrunde liegenden Anlage und liefert demzufolge eine unentbehrliche Information beim ungesicherten Einsatz von Optionen.
Dass informationsmotivierte Transaktionen häufig (respektive nach Möglichkeit) über Options- und Futuresmärkte statt über die zugrunde liegenden Kassamärkte abgewickelt werden, ist neben den erwähnten Anlagemerkmalen von Optionen ferner auf die Struktur dieser Märkte zurückzuführen. Erwartungsänderungen über die aggregierte Aktienmarktentwicklung, über einen spezifischen Sektor oder über die Zinsstruktur lassen sich durch Aktienindex- und Zinsoptionen einfacher und billiger umsetzen, als wenn einzelne Aktien und Anleihen gekauft oder verkauft werden müssten. Aber auch firmenspezifische Informationen werden aufgrund der größeren Anonymität derivativer Märkte nach Möglichkeit nicht über den Kassamarkt umgesetzt. Dies bewirkt, dass kursrelevante Informationen häufig nicht direkt, sondern über Options- und Futuresmärkte in den Kassamarkt getragen werden (vergleiche Abschnitt IV. 2.).
2. Absicherung
Eine der wichtigsten Verwendungsmöglichkeiten von Optionsgeschäften liegt im kombinierten Einsatz der Optionen mit den zugrunde liegenden Kassainstrumenten zum Zwecke der Risikobegrenzung. Während Optionen, für sich betrachtet, durchaus volatile und risikobehaftete Anlagen darstellen (Hebeleffekt), vermögen sie in Verbindung mit traditionellen Anlageformen das Portfoliorisiko maßgeblich und selektiv einzuschränken. So lassen sich beispielsweise die Verluste eines Aktienportfolios durch den Kauf von Putoptionen auf einen Aktienindex (der dem Portfolio möglichst ähnlich ist) auf ein subjektiv gewünschtes Ausmaß begrenzen, je nach Ausübungspreis und Anzahl der gekauften Kontrakte. Da die Putoptionen hier quasi die Funktion eines Versicherungskontraktes erfüllen, bezeichnet man diese Strategie als Portfolio-Insurance (Schwartz, E. 1986/1987). Im Gegensatz zur Absicherung mit Index-Futures werden hier die Kursgewinne und -verluste nicht gleichermaßen eingeschränkt, sondern das Gewinnpotenzial wird bis auf den zu leistenden Optionspreis aufrechterhalten. Der Optionspreis widerspiegelt gewissermaßen die Prämie für den Versicherungsschutz. Seit einigen Jahren bieten Banken verschiedene Anlageinstrumente an, wo ein indexierter Vermögenswert gegenüber Verlusten abgesichert ist respektive eine Mindestrendite garantiert wird. Diese werden als strukturierte Produkte bezeichnet und stellen eine direkte Umsetzung des Konzeptes der Portfolio-Insurance dar.
Eine verbreitete Strategie ist das Schreiben von Calloptionen auf vorhandene Wertpapierbestände (Covered call writing). Durch diese Strategie werden die gehaltenen Papiere zu einem bestimmten Ausübungspreis abgetreten. Die Gegenpartei wird diese Option bei „ hohen “ Aktienkursen ausüben. Im Unterschied zur Portfolio-Insurance wird durch diese Strategie, abgesehen vom eingenommenen Optionspreis, das Gewinn- und nicht das Verlustpotenzial des Aktienportfolio beschnitten. Durch das Schreiben von Calloptionen erreicht man also durchaus eine Begrenzung der Volatilität der zugrunde liegenden Anlage, aber nicht im Sinne der Absicherung potenzieller Verluste. Beim Einsatz von Optionen muss deshalb stets beobachtet werden, in welche Richtung sich die Renditeverteilung aufgrund der asymmetrischen Payoffs der Instrumente verschiebt.
Die Palette der durch Optionen realisierbaren Absicherungsmöglichkeiten ist sehr breit: Ein Exporteur kann durch Devisenoptionen unerwartete Kurseinbußen auf in ausländischer Währung fakturierten Guthaben vermeiden, aber sich gleichzeitig die Chance von Wechselkursgewinnen offen halten; ein Emittent, der in 6 Monaten eine Emission tätigt, kann sich durch Zinsoptionen gegenüber steigenden Zinssätzen absichern, aber bei fallenden Sätzen trotzdem von den günstigeren Finanzierungskonditionen profitieren.
3. Arbitrage
Durch Arbitragegeschäfte versuchen Marktteilnehmer und Investoren, Preisunterschiede zwischen Optionen und den zugrunde liegenden Kassainstrumenten oder zwischen unterschiedlichen Optionen auszunützen. Arbitrage liegt dann vor, wenn sich diese Preisunterschiede (nahezu) ohne Kapitaleinsatz und Preisrisiko ausnützen lassen. Die besondere Natur der Optionen ermöglicht die Spezifikation sogenannter Arbitragerelationen. Das zugrunde liegende Prinzip ist relativ einfach: Wenn zwei Anlagen (oder Portfolios) über alle Zustände (Aktienkurse, Zinssätze, etc. ) und Zeitpunkte dieselben Payoffs aufweisen, so muss auch ihr heutiger Wert übereinstimmen (Law of one Price). Wenn dies nicht der Fall wäre, dann könnte man durch den Kauf der relativ billigeren Anlage und den Verkauf der relativ teureren einen risikolosen Gewinn erwirtschaften. Man bezeichnet dies als Arbitragegewinn. In der Praxis sorgt die Konkurrenz zwischen professionellen Arbitrageuren allerdings dafür, dass solche Gewinne sehr begrenzt oder zumindest zeitlich sehr kurzlebig sind. Auf diese Weise wird ein konsistentes Preissystem zwischen Kassa-, Futures- und Optionsmärkten erzeugt, und die Marktpreise gelten als „ fair “ . Dies stellt nicht nur eine Voraussetzung für eine volkswirtschaftlich effiziente Allokation der Risiken dar, sondern reduziert die Informationsbeschaffungskosten der Marktteilnehmer hinsichtlich der relativen Über- und Unterbewertung der gehandelten Instrumente. Letzteres ist gerade bei Optionsmärkten in Anbetracht der großen Menge von Preisinformationen (Calls/Puts, Laufzeiten, Ausübungspreise, Basiswerte) besonders bedeutungsvoll. In welchem Umfang Arbitrage betrieben wird, ist neben der Liquidität der Märkte entscheidend von den fiskalischen und regulatorischen Restriktionen, denen Arbitragetransaktionen unterworfen sind, abhängig (Transaktionskosten, Steuern, Verbot von Leerverkäufen, etc.)
IV. Preisbildung und ökonomische Bedeutung von Optionen
1. Dynamische Replikation und Arbitragebewertung von Optionen
Die Theorie zur Bewertung von Optionen stellt einen weit fortgeschrittenen Bereich der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung dar. Die grundlegenden Beiträge von Black/Scholes und Merton legten die Basis für die moderne Optionsbewertungstheorie (Black, /Scholes, 1973; Merton, 1973). Dabei wird der Preis einer Option als „ fair “ bezeichnet, wenn es keine Strategien gibt, aufgrund welcher Arbitragegewinne zwischen der Option und der zugrunde liegenden Anlage erwirtschaftet werden können. Es lässt sich nun zeigen, dass der zukünftige Payoff einer Option unter geeigneten Annahmen über die Volatilität der Basisanlage durch ein dynamisch angepasstes Portfolio, bestehend aus der Basisanlage und einer risikolosen Anlage, exakt repliziert werden kann. Damit werden Optionen zu „ redundanten “ Instrumenten. Arbitragefreiheit impliziert, dass der heutige Wert einer Option genau mit dem heutigen Wert des replizierenden Portfolios übereinstimmt. Eine wesentliche Implikation der Arbitragebewertungstheorie von Optionen ist insbesondere, dass eine Calloption (Putoption) äquivalent ist mit einer long (short) Position in einem festverzinslichen Instrument.
Zentrales Element für die dynamische Replikationsstrategie und damit für die Optionsbewertung ist die Annahme über die Stochastik der Kurse der Basisanlage. Im einfachsten Fall (Black-Scholes-Merton-Modell) wird diese durch die Standardabweichung der relativen Kursveränderungen, die sog. Volatilität des Prozesses, beschrieben. Die Volatilität lässt sich allerdings im Zeitpunkt der Optionsbewertung nicht direkt beobachten, sondern muss für die Zeit bis zum Optionsverfall geschätzt werden. Es sind demzufolge die Erwartungen der Marktteilnehmer hinsichtlich der zukünftigen Volatilität der Basisanlage, welche sich in den am Markt beobachteten Optionspreisen widerspiegeln. Je höher die antizipierte Volatilität ist, um so höher fallen die Optionspreise aus. Die Volatilitätserwartungen, welche sich in den am Markt bezahlten Optionspreisen niederschlagen, bezeichnet man als implizite Volatilitäten. Sie können nur unter Verwendung eines spezifischen Optionspreismodells bestimmt werden, sind also modellabhängig.
2. Allokative Gesichtspunkte
Naheliegenderweise wird man die Hauptfunktion der Optionsmärkte in der Risikoumverteilung zwischen Wirtschaftssubjekten vermuten: Risiken werden gegen Leistung des Optionspreises von den Absicherern zu den Spekulanten transferiert. Es muss jedoch beachtet werden, dass diese allokative Funktion aus den Annahmen der klassischen Optionspreistheorie nicht zwingend folgt. Diese beruht ja auf der Prämisse, dass Optionen redundante Anlagen darstellen und demzufolge durch bestehende Anlagen replizierbar sind. Es stellt sich damit die Frage, wozu unter diesen Voraussetzungen überhaupt Optionen benötigt werden (Hakannsson, N. 1979). Eine Reihe von Argumenten lassen sich finden, doch stellen diese im Gegenzug – soweit sie tatsächlich berechtigt sind – den Arbitragebewertungsansatz in Frage. Somit steht man vor dem Dilemma, dass entweder die Preisbildung von Optionen „ einfach “ ist und dafür die allokative Bedeutung von Optionen unklar bleibt, oder dass man gute Gründe für die ökonomische Bedeutung von Optionsmärkten kennt, aber dafür die Preisbildung nicht aufgrund der konventionellen Arbitrageansätze erfolgen kann.
Grundlage für die risiko-allokative Rolle von Optionen bildet die Beobachtung, dass Optionen unvollständige Finanzmärkte vervollständigen (Ross, St. 1976). Populär formuliert bedeutet dies, dass durch die Einführung von Optionen das Risiko- /Rendite-Spektrum der bestehenden Anlagemöglichkeiten in einer Weise erweitert wird, wie dies sonst nur durch dynamische Portfoliostrategien möglich wäre. Der Grund für diese allokative Leistung liegt, wie an anderer Stelle (Abschnitt IV. 1) erwähnt, darin, dass sich Optionen durch dynamische Portfoliostrategien mit bestehenden Anlagen replizieren lassen. Mit der Einführung von Optionskontrakten erübrigt sich die Implementation dieser Strategien. Damit stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Implementation einer dynamischen Strategie äquivalent mit der Verwendung einer Option ist. Drei Gesichtspunkte stehen dabei im Vordergrund:
1) Bei der periodischen Adjustierung des replizierenden Portfolios fallen Transaktionskosten an; dies bewirkt, dass das Portfolio optimalerweise nur in gewissen zeitlichen Abständen, sicher aber weniger häufig angepasst wird, als sich der zugrunde liegende Kurs verändert. Eine perfekte Replikation einer Option setzt jedoch voraus, dass das Portfolio laufend, d.h. im Anschluss an jede Aktienkursänderung, angepasst werden kann. Insbesondere bei starken Kursänderungen (beispielsweise einem Crash) wird dies nicht immer möglich sein, und der Wert des replizierenden Portfolios kann substantiell vom Payoff der Option abweichen.
2) Optionsmärkte, und insbesondere auch Futures-Märkte, bewirken eine verbesserte Preisfindung (Price discovery) auf den zugrunde liegenden Kassamärkten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Options- und Futuresmärkte oftmals aktuellere Preisinformationen erzeugen und die Preisfindung am Kassamarkt über die Arbitrage verbessert wird.
3) Damit Optionen dynamisch repliziert werden können, muss der stochastische Preisprozess der zugrunde liegenden Anlage bekannt sein. Im einfachsten Fall (Black-Scholes-Merton-Modell) erfordert dies die Kenntnis der Volatilität der Preisänderungen der zugrunde liegenden Anlage. Diese Annahme kann aus verschiedenen Gründen verletzt sein, gerade wenn dynamische Replikationsstrategien ausgiebig verwendet werden, wie dies beispielsweise in den 1980er-Jahren im amerikanischen Aktienmarkt der Fall gewesen ist. Der hauptsächlichste Grund dafür war das Fehlen eines liquiden Marktes für langfristige europäische Call- und Putoptionen auf Aktienindizes, wie sie zur Absicherung großer institutioneller Portfolios benötigt würden. Da diese Strategien prinzipiell zyklischer Natur sind (sell low, buy high; vgl. Rubinstein, M./Leland, H. 1981), vermögen sie fundamentale Aktienkursschwankungen zu verstärken. Dies wird vor allem dann der Fall sein, wenn die dadurch ausgelösten Transaktionen unerwartet auf dem Finanzmarkt eintreffen und eine vorübergehende Störung des Marktgleichgewichtes bewirken. Wenn die Volatilität von Kassamärkten von der Verbreitung dynamischer Absicherungsstrategien abhängig ist, aber das Ausmaß der Verbreitung im Zeitpunkt der Implementation dieser Strategien unbekannt ist, so bedeutet dies, dass die Volatilität des Kassamarktes im Voraus nur schwer abgeschätzt werden kann. Damit besteht immer die Gefahr, dass dynamische Replikationsstrategien auf Volatilitätserwartungen ausgerichtet werden, welche unter Umständen nicht mit einem späteren Marktgleichgewicht konsistent sind.
Wenn demgegenüber für die Absicherung börsengehandelte Optionskontrakte verwendet werden können, wird der Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage nach Absicherungsmöglichkeiten über einen Marktmechanismus koordiniert und äußert sich nicht in unerwarteten Aktienkäufen oder -verkäufen. Eine relativ zum Angebot unerwartet große Nachfrage nach Absicherungskontrakten würde sich frühzeitig in hohen Optionspreisen, d.h. hohen impliziten Volatilitäten, widerspiegeln (Grossman, S. 1988). Der entscheidende Punkt liegt darin, dass diese Marktinformationen in die Entscheidungen der Marktteilnehmer einfließen: Wer erwartet, dass die implizite Volatilität über der tatsächlichen Volatilität liegt, würde entweder die Nachfrage nach Absicherung (Kauf von Optionen) einschränken oder das Angebot (Verkauf von Optionen) vergrößern. Dieser Ausgleichsmechanismus fehlt bei einer ausschließlichen Implementation dynamischer Strategien weitgehend, da in diesem Fall die Entscheidungen nicht auf Marktinformationen bezüglich der Volatilität der zugrunde liegenden Anlage abgestützt werden können, sondern auf subjektiven Erwartungen beruhen müssen. In der Aggregation von Volatilitätserwartungen kann denn auch eine zentrale ökonomische Funktion von Optionsmärkten erkannt werden. Durch Optionsmärkte, wie durch Terminmärkte generell, verfügt man über Institutionen, über deren Preissystem spätere potenzielle Ungleichgewichte des Kassamarktes ex ante erkannt und abgeschwächt werden können (Zimmermann, H. 1989). Populär formuliert heißt dies, dass durch einen Optionsmarkt die Volatilität des zugrunde liegenden Kassamarktes in Form von Finanzkontrakten handelbar und mit einem Marktpreis versehen wird.
3. Regulierung
Gegenüber Options- und Futures-Geschäften werden Vorbehalte unterschiedlichster Art vorgebracht. Es wird argumentiert, dass sie die spekulativen Aktivitäten auf den Finanzmärkten erhöhen und damit zu einer größeren Volatilität dieser Märkte beitragen würden, was letztlich sogar das Finanzsystem einer Wirtschaft destabilisieren könne. Zunächst gilt festzuhalten, dass sich empirisch keine destabilisierenden Effekte organisierter Options- und Futuresmärkte nachweisen lassen, selbst nicht im Zusammenhang mit dem Börsenkrach im Jahr 1987 (New York Stock Exchange, 1990; Miller, M. 1991). Auch weisen Preislimits, Handelsunterbrüche, restriktive Margenregeln, das Unterlassen automatisierter Arbitragetransaktionen (Programmhandel), u.a. keine nachweisbaren, stabilisierenden Auswirkungen auf die Finanzmärkte auf. Regulatorische Maßnahmen, welche auf die aufgeführten Argumente zurückgreifen, gefährden die Funktionsfähigkeit der Options- und Futuresmärkte und ihre allokativen Wirkungen. Wichtigste Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit dieser Märkte ist das möglichst ungehinderte Zusammenspiel von Arbitrage, Spekulation und Absicherung. Arbitrageure bewirken ein konsistentes Preissystem; Hedgers verwenden Optionen zum Transfer unerwünschter Risiken und beurteilen die Optionspreise aufgrund der damit verbundenen Hedge-Kosten; Spekulanten übernehmen das Preisrisiko gegen Entschädigung durch den Optionspreis, setzen subjektive Erwartungen in gewinnbringende Strategien um und tragen dadurch neue Informationen in den Kapitalmarkt. Wann immer eine dieser Funktionen durch eine regulatorische Maßnahme beschnitten oder behindert wird, schränkt dies die Leistungsfähigkeit des Optionsmarktes bei der Allokation von Risiken und der Verarbeitung/Erzeugung von Informationen ein. Die Beschränkung oder Besteuerung spekulativer Aktivitäten entzieht beispielsweise dem Markt jenes Kapital, welches als Gegenseite von Absicherungsgeschäften benötigt wird und führt letztlich zu einer Verteuerung von letzteren. Die Unterstellung der Optionsgeschäfte unter die Normen von „ Spiel und Wette “ , wie sie in der Anfangszeit von Optionsbörsen fast überall erwogen wurde, dürfte nur eine extreme Form der Behinderung dieser Märkte darstellen. Aber auch eine asymmetrische steuerliche Behandlung von Kursgewinnen und -verlusten aus Optionen lässt sich nicht rechtfertigen, wenn die Instrumente im Rahmen einer Absicherungsstrategie eingesetzt werden, d.h. Kursgewinne auf Optionen zur Kompensation von Kursverlusten im Kassamarkt dienen.
Verschiedene Bestrebungen sind im Gang, den Handel in derivativen Instrumenten – soweit diese an organisierten Börsen gehandelt werden – einer verstärkten Aufsicht zu unterstellen. Die Komplexität sowie die Risiken eines falschen, illusionären oder ungesicherten Einsatzes derivativer Instrumente sind die hauptsächlichsten Argumente zugunsten eines verbesserten Anleger- und Systemschutzes. Auch wenn diese Anliegen in einem gewissen Umfang berechtigt sein mögen, sollte beachtet werden, dass die gesamtwirtschaftlichen Risiken, aus denen ein Regulierungsbedarf abgeleitet werden kann, gerade nicht bei den börsenmäßig gehandelten Instrumenten entstehen, sondern im exponentiell wachsenden Segment der außerbörslich gehandelten OTC-Instrumente. Dazu gehören weniger Optionsgeschäfte im klassischen Sinn, als v. a. derivative Zins- und Währungsinstrumente. Der Handel in diesen Instrumenten weist vor allem bezüglich Volumen, Schuldnerqualität und Liquidität nicht dieselbe Transparenz auf wie der börsenmäßige Handel mit Derivaten, und es bestehen aufgrund seiner globalen (grenzüberschreitenden)Struktur kaum Ansätze für eine adäquate aufsichtsrechtliche Erfassung der damit verbundenen Risiken. Die Diskussion über die Regulierung des Handels mit derivativen Instrumenten wird sich zukünftig mehr mit diesem Problem als mit der Aufsicht über börsenmäßig gehandelte Instrumente befassen müssen.
Literatur:
Bernstein, P. : Capital Ideas, New York 1992
Black, F. : Facts and Fantasy in the Use of Options, in: FAJ 1975, S. 36 – 41, 61 – 72
Black, F./Scholes, M. : The Pricing of Options and Corporate Liabilities, in: Jpol. E 1973, S. 637 – 659
Cox, J./Rubinstein, M. : Option Markets, Englewood Cliffs 1985
Eller, R. : Handbuch derivativer Instrumente, Stuttgart 1996
Gastineau, G. : The Options Manual, 3. A., New York 1984
Grossman, S. : Insurance Seen and Unseen, in: JoPM 1988, S. 5 – 8
Hakannsson, N. : The Fantastic World of Finance: Progress and the Free Lunch, in: Jfin. Quant. Anal. 1979, S.717 – 724
Hull, J. : Options, futures and other derivatives, New York, 4.A., 2000
Merton, R. : Theory of Rational Option Pricing, in: Bell Journal of Economics and Management Science 1973, S. 141 – 183
Miller, M. : Financial Innovation and Market Volatility, New York 1991
New York Stock Exchange, : Market volatility and Investor Confidence: Report to the Board of Directors of the NYSE, New York 1990
Ross, St. : Options and Efficiency, in: QJE 1976, S. 75 – 89
Rubinstein, M./Leland, H. : Replicating Options with Positions in Stocks and Cash, in: FAJ 1981, S. 63 – 72
Schwartz, E. : Options and Portfolio Insurance, in: FuPM 1986/1987, S. 9 – 17
Zimmermann, H. : Informationen, Volatilität und Finanzmärkte. Zur volkswirtschaftlichen Rolle von Aktienindexmärkten, in: Wirtschaft und Recht, 1989, S. 152 – 174
|